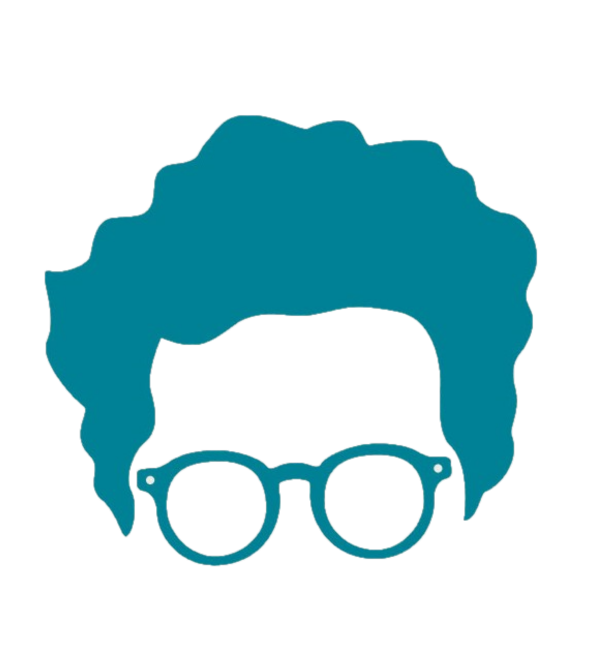Es gibt politische Reformen, die mit guten Absichten beginnen und mit schlechten Strukturen enden. Die Minijobs gehören dazu. Ursprünglich als unbürokratische Möglichkeit gedacht, kleine und gelegentliche Tätigkeiten in privaten Haushalten legal zu machen, sind sie längst zu einem eigenen Arbeitsmarkt geworden – jenseits der sozialen Ordnung, auf der unser Arbeitsmarkt und Sozialstaat ruhen.
Heute arbeiten zwischen sechs und acht Millionen Menschen in einem Minijob. Was einst die Ausnahme war, ist zum Regelfall geworden – besonders in Branchen wie Gastronomie, Handel oder Reinigung. Für viele ist der Minijob nicht bloß ein Hinzuverdienst, sondern die Hauptquelle ihres Erwerbseinkommens. Damit hat sich der Charakter dieser Beschäftigungsform grundlegend verändert.
Die Idee der geringfügigen Beschäftigung war ursprünglich einfach: Wer nur kurzzeitig oder mit sehr geringem Einkommen arbeitet, sollte nicht in das volle Sozialversicherungssystem einbezogen werden. Diese Logik beruhte auf der Annahme, dass solche Tätigkeiten eben nur temporär sind und nicht der Existenzsicherung dienen – eine Nebenbeschäftigung für Studierende, Rentner oder Hausfrauen. Diese Annahme gilt längst nicht mehr. Statt Brücke in reguläre Arbeit sind Minijobs für viele zu einer Hängebrücke geworden: Sie versprechen einen Übergang, aber führen selten wirklich hinüber. Zahlreiche Studien zeigen, dass ein großer Teil der Minijobberinnen und Minijobber gern mehr arbeiten würde – dieser Wunsch ist laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) besonders bei Frauen ausgeprägt. Doch oft fehlt es an passenden Angeboten, an Aufstiegsmöglichkeiten oder an einer verlässlichen Stundenaufstockung durch die Betriebe. Aus einem Instrument der Flexibilität wurde ein Mechanismus der Fragmentierung: Reguläre Arbeitsplätze werden aufgeteilt, Arbeitszeiten kleingerechnet und aus sozialversicherungspflichtiger Arbeit wird Stückwerk.
Ordnungspolitisch sind Minijobs ein Fremdkörper in unserer Arbeitswelt. Denn unsere Sozialversicherungssysteme beruhen auf dem Prinzip des Normalarbeitsverhältnisses – auf kontinuierlicher, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die Erwerb und Absicherung verbindet. Nur wenn viele in regulären Jobs arbeiten und Beiträge leisten, trägt sich das System. Wer also in einer regulären Beschäftigung arbeitet, trägt über Beiträge im Solidarprinzip zur Gemeinschaft bei. Wer aber in einem Minijob arbeitet, ohne einzuzahlen, entzieht dem System Mittel und Legitimation. Das Prinzip „Brutto gleich Netto“ klingt verlockend, ist aber im Kern unsozial: Es verlagert die Kosten der Absicherung in Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit auf die Allgemeinheit. Die Folgen sind absehbar: geringere Einnahmen in der Sozialversicherung, steigende Ausgaben in der Grundsicherung. Was als Entlastung begann, wird zur Belastung – für das System, das gerade die Schwächsten schützen soll.
Am Ende zahlt nicht nur das System den Preis, sondern auch die Menschen: Wer sein Leben lang im Minijob arbeitet, steht im Alter mit leeren Händen da. Altersarmut ist damit kein Zufall, sondern ein eingebauter Systemfehler. Minijobs untergraben so nicht nur das Solidarprinzip, sondern auch das Leistungsversprechen unseres Sozialstaats: Wer arbeitet, soll im Alter nicht arm sein.
Hinzu kommt: In Minijobs findet kaum Weiterbildung statt, Qualifikationen veralten, Aufstieg bleibt aus. Frauen, die nach einer Familienphase zurückkehren, verharren oft dauerhaft in Teilzeit oder im Minijob – ökonomisch abhängig und sozial ungeschützt. Was als flexible Übergangslösung begann, zementiert alte Rollenbilder.
Minijobs unterlaufen nicht nur das Solidarprinzip, sie schwächen auch die Ordnung des Arbeitsmarktes – weil sie ein Sonderrecht schaffen, das die Regeln fairer Konkurrenz aushebelt. Wo sie überhandnehmen, sinken Standards. In vielen Fällen werden Urlaubs- oder Krankheitsansprüche nicht gewährt, Überstunden nicht bezahlt, Mindestlöhne umgangen. Der Staat schafft damit eine Parallelwelt der Arbeit, in der die gleichen Tätigkeiten zu unterschiedlichen Bedingungen stattfinden. Für Arbeitgeber mögen Minijobs kurzfristig bequem sein, langfristig aber höhlen sie den fairen Wettbewerb aus: Minijobs entziehen sich dem Solidarprinzip, weil ihre Pauschalabgaben keine vollen Ansprüche in der Sozialversicherung begründen – und sie zugleich steuerlich begünstigt sind. Das ist nicht marktwirtschaftlich, das ist Wettbewerbsverzerrung per Gesetz.
Ein moderner Arbeitsmarkt braucht keine Privilegien für Kleinstjobs. Er braucht klare Regeln, die Arbeit und Sicherheit wieder zusammenführen. Minijobs gehören auf ihren ursprünglichen Zweck zurückgeführt – als Übergangsform für Schüler oder Rentner, nicht als Ersatzstruktur für reguläre Beschäftigung. Der Weg dahin führt über klare gesetzliche Änderungen – hin zur Abschaffung der Minijobs als Dauerbeschäftigungsform. Übergangsfristen und sozialverträgliche Modelle sind nötig, aber das Ziel ist eindeutig: Wer arbeitet, soll sozial abgesichert sein. Schritt für Schritt müssen Minijobs in reguläre Beschäftigung überführt werden – mit fairen Beiträgen, echten Rechten und realen Aufstiegschancen.
Denn die Ordnung der Arbeit entscheidet über den Zusammenhalt der Gesellschaft. Arbeit ist mehr als Erwerb – sie ist Teilhabe, Verantwortung und Beitrag zur Gemeinschaft. Ein Sozialstaat, der das ernst nimmt, darf keine Beschäftigungsformen fördern, die Solidarität zur Option machen.